Das Bundesgericht schlägt der Bundesversammlung für die Amtsperiode 2025 bis 2026 Herrn Bundesrichter François Chaix zur Wahl als Bundesgerichtspräsidenten und Herrn Bundesrichter Francesco Parrino zur Wahl als Vizepräsidenten vor. Als drittes Mitglied der Verwaltungskommission hat das Gesamtgericht Frau Bundesrichterin Marianne Ryter gewählt. In fünf der acht Abteilungen des Bundesgerichts kommt es auf Anfang 2025 zu einem Wechsel des Abteilungspräsidiums. In der Wintersession wird die Vereinigte Bundesversammlung auf Vorschlag des Bundesgerichts das Präsidium und das Vizepräsidium des Bundesgerichts für die Amtsperiode 2025 bis 2026 wählen.
Niederer Kraft Frey war Beraterin der Franke Gruppe bei der Übernahme der WESCO Gruppe. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung. Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Lösungen und Geräten für die Haushalts- und Profiküche sowie für die Kaffeezubereitung. Das Unternehmen ist weltweit präsent und beschäftigt rund 7'700 Mitarbeitende in 35 Ländern. Der Nettoumsatz beläuft sich auf rund CHF 2,42 Milliarden.
Die SRG hat mit der Ausstrahlung der Bundesratsansprache zur "Frontex-Vorlage" auf Radio SRF vor der Abstimmung vom 15. Mai 2022 das Vielfaltsgebot nicht verletzt. Wegen des besonderen Charakters der Bundesratsansprachen sind weniger strenge Anforderungen an das Vielfaltsgebot zu stellen als bei anderen abstimmungsrelevanten Sendungen. Das Bundesgericht heisst im Urteil 2C_871/2022 vom 28. August 2024 die Beschwerde der SRG gegen den Entscheid der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen gut.
Die Schweizerische Post hat den Kauf der Open Systems von EQT und weiteren Miteigentümern vereinbart. Open Systems ist ein führender Anbieter von Netzwerk- und Cybersecurity-Lösungen auf einer cloud-basierten Plattform, sog. Secure Access Service Edge (SASE). Walder Wyss berät die Schweizerische Post als Lead Counsel in allen rechtlichen Belangen der Transaktion zusammen mit Van Doorne (Niederlande), Gleiss Lutz (Deutschland), Honigman (USA) und Khaitan & Co (Indien).
Walder Wyss teilt mit, dass Aude Peyrot als neue Partnerin dem Genfer Büro beigetreten ist. Dr. Aude Peyrot ist eine anerkannte Spezialistin für Erbrecht. Als Trust and Estate Practitioner (TEP) berät sie schweizerische und ausländische Klienten in der Nachlassplanung und unterstützt sie bei nationalen und internationalen Streitigkeiten mit komplexen Strukturen (Trusts, Stiftungen usw.). Sie wird seit mehreren Jahren in Who's Who Legal (Schweiz) als «führende Privatkundenanwältin» geführt. Sie ist auch im Immobilienrecht (Immobilientransaktionen und -entwicklungen), im Bankprozessrecht und im Zwangsvollstreckungsrecht (einschliesslich Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile) tätig. Herzliche Gratulation!
Dr. Simone Nadelhofer (3. v.l.) und Matthias Gstoehl (l.) wechselten per heute als Partner von LALIVE zu Schellenberg Wittmer. Dr. Simone Nadelhofer ist Expertin für die Abwicklung komplexer inländischer und grenzüberschreitender Verfahren sowie interner und staatlicher Untersuchungen mit Schwerpunkt auf Wirtschafts- und Finanzkriminalität, einschliesslich Korruption, Betrug, Geldwäsche, Cyberkriminalität, ESG und Verstößen am Arbeitsplatz. Matthias Gstoehl bringt umfangreiche Erfahrung in komplexen nationalen und länderübergreifenden Verfahren und (internen) Untersuchungen mit. Seine Expertise umfasst Wirtschaftskriminalität, einschließlich Korruption, Betrug und Geldwäsche, Vermögensrückgewinnung, Insolvenz, internationale Rechtshilfe, internationale Sanktionen und ESG-Rechtsstreitigkeiten. Sowohl Simone Nadelhofer als auch Matthias Gstoehl werden in Zürich ansässig sein und damit die führende Position der Kanzlei in den Bereichen Streitbeilegung und Wirtschaftskriminalität weiter stärken. Auf dem Bild sind weiter Dr. Stéphanie Chuffart-Finsterwald, Partnerin, sowie Petra Spring, Counsel (r.), zu sehen.
Am 23. September 2024 im Widder Hotel die Premiere des neuen Formats von LAWSTYLE® EDUCATION statt. Dr. Kenad Melunović Marini, Rechtsanwalt und Fachanwalt SAV Strafrecht präsentierte das Thema «Prozessieren vor Bundesgericht». Nach dem ersten Teil mit theoretischen Ausführungen und Praxistipps konnten im Workshop die zahlreich erschienenen Teilnehmenden selber an Urteilen des Bundesgerichts arbeiten. Die nächste Durchführung dieser Fortbildung mit beschränkter Teilnehmendenzahl folgt im Jahr 2025.
Das ist die erste Folge vom neuen LAWSTYLE® YOUNG Podcast. Das VISCHER Summer Trainee Programm 2024 startete am 15. Juli 2024 und dauert acht Wochen. Die vier Summer Trainees erhalten dabei einen fundierten Einblick in das anwaltliche Berufsleben, jeweils unterstützt durch eine «Gotte» oder einen «Götti». Neben der praktischen Arbeit an Mandaten aus verschiedenen Fachgebieten nehmen sie an «Case Study Lunches» und zahlreichen anderen fachlichen und sozialen Veranstaltungen teil. Wir sprechen im von Robin A. Brunner moderierten Podcast mit Rona Lengen und Noah Casot über ihre Erfahrungen.
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 28. August 2024 den aktualisierten Verhaltenskodex für das Personal der Bundesverwaltung genehmigt. Dieser fasst die wichtigsten Grundsätze zusammen, die das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Bundesverwaltung sichern. Er tritt auf den 1. Oktober 2024 in Kraft und ersetzt den bisherigen Kodex, der seit 2012 gilt.
Baker McKenzie berät die Privatbank IHAG Zürich AG (PB IHAG) beim Verkauf ihres Kundengeschäfts an die Bank Vontobel AG im Rahmen eines Asset Deals. Vontobel erwirbt das Geschäft der PB IHAG und unterstützt damit ihr strategisches Ziel, ihre Präsenz in ihren Fokusmärkten auszubauen. Die Transaktion wird aus dem bestehenden Kapital von Vontobel finanziert. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen wird die Transaktion voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen.
HAYA Therapeutics AG, ein Schweizer Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit auf dem Gebiet der präzisen RNA-gesteuerten regulatorischen Genom-Targeting-Therapien leistet, gab eine mehrjährige Vereinbarung mit Eli Lilly and Company bekannt, um die fortschrittliche RNA-gesteuerte regulatorische Genom-Plattform von HAYA zur Unterstützung der präklinischen Arzneimittelforschung bei Adipositas und verwandten Stoffwechselkrankheiten einzusetzen. Die Partner werden mehrere vom regulatorischen Genom abgeleitete RNA-basierte Zielmoleküle für die Behandlung dieser chronischen Erkrankungen identifizieren. VISCHER beriet HAYA Therapeutics AG in Bezug auf die schweizerischen rechtlichen Aspekte dieser Transaktion. Cooley war bei dieser Transaktion als Lead Counsel tätig.

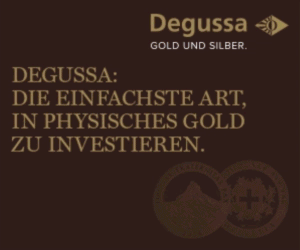


SOCIAL MEDIA